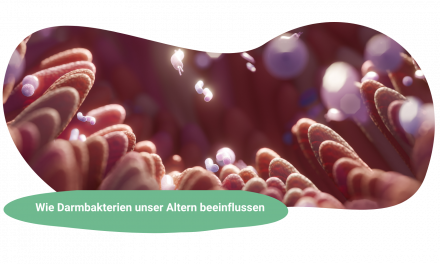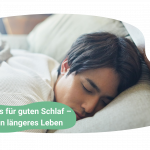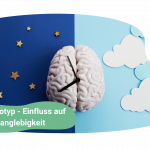Unsere Gesellschaft altert zunehmend, und damit rückt ein Thema verstärkt in den Fokus: Wie können wir die Lebensqualität im Alter erhalten? Neben Bewegung, sozialer Teilhabe und medizinischer Versorgung erzählt uns die Wissenschaft klar: die Ernährung spielt eine entscheidende Rolle. Besonders interessant ist dabei die Frage, wie bestimmte Inhaltsstoffe zur Vorbeugung von Altersgebrechlichkeit beitragen können. Von besonderem Interesse sind hier pflanzliche Inhaltsstoffe, die durch ihre Vielfalt und bioaktiven Eigenschaften im Mittelpunkt aktueller Forschung stehen.
Eine wachsende Zahl an Studien zeigt, dass sekundäre Pflanzenstoffe – insbesondere die sogenannten Polyphenole – einen wichtigen Beitrag leisten können. Diese Substanzen, die in Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen, Tee, Kaffee oder Olivenöl vorkommen, wirken nicht nur antioxidativ und entzündungshemmend. Sie scheinen auch direkt auf Prozesse einzuwirken, die für Muskelkraft, Herz-Kreislauf-Funktion und allgemeine Vitalität relevant sind. Besonders spannend: Neue Daten weisen darauf hin, dass bereits drei Portionen polyphenolreicher Lebensmittel täglich das Risiko für Altersgebrechlichkeit um bis zu ungefähr 15 % senken könnten. Das unterstreicht, wie groß der Einfluss bewusster und gezielter Ernährungsentscheidungen auf den Alterungsprozess sein kann – und dass Prävention oft einfacher ist, als man denkt.
Im folgenden Beitrag werfen wir daher einen genaueren Blick auf sekundäre Pflanzenstoffe. Wir klären, was sie sind, wie sie im Körper wirken und welche Lebensmittel besonders reich daran sind. Außerdem gucken wir uns die wissenschaftliche Evidenz an und geben praktische Tipps, wie sich polyphenolreiche Kost mühelos in den Alltag integrieren lässt.
Was sind sekundäre Pflanzenstoffe?
Sekundäre Pflanzenstoffe sind bioaktive Substanzen, die in Pflanzen neben den bekannten Nährstoffen wie Kohlenhydraten, Proteinen, Fetten, Vitaminen und Mineralstoffen vorkommen. Während diese „primären“ Stoffe für Wachstum und Energieversorgung der Pflanze unentbehrlich sind, erfüllen sekundäre Pflanzenstoffe vor allem Schutz- und Kommunikationsfunktionen (Panche et al., 2016). Sie wehren Schädlinge ab, locken Bestäuber an oder helfen der Pflanze, sich an Umweltstress anzupassen. Für den Menschen sind sie zwar nicht essentiell im klassischen Sinn, haben aber nachweislich gesundheitsfördernde Effekte (Cory et al., 2018).
Die Gruppe der sekundären Pflanzenstoffe ist sehr vielfältig: Mehr als 100.000 verschiedene Verbindungen sind bislang beschrieben. Sie lassen sich grob in mehrere Hauptgruppen einteilen, darunter Carotinoide, Glucosinolate, Phytoöstrogene und vor allem Polyphenole. Gerade Polyphenole stehen in den letzten Jahren im Zentrum der Forschung, weil sie antioxidative und entzündungsmodulierende Eigenschaften besitzen. Das heißt, ein Stoff kann entweder entzündungshemmend wirken oder die Stärke und Dauer einer Entzündungsreaktion modulieren, also anpassen. Bei Polyphenolen meint man damit, dass sie Entzündungen abschwächen oder kontrollieren können, ohne das Immunsystem komplett zu blockieren. (Tsao, 2010).
Polyphenole kommen in zahlreichen alltäglichen Lebensmitteln vor. Besonders reich sind zum Beispiel Beeren, Trauben, Äpfel, Olivenöl, grüner Tee, Kaffee, Nüsse und sogar dunkle Schokolade (Pérez-Jiménez et al., 2010). Je nach Struktur unterscheidet man Untergruppen wie Flavonoide, Phenolsäuren oder Stilbene (Beecher, 2003). Diese Vielfalt macht es möglich, über eine abwechslungsreiche Ernährung eine große Bandbreite an Substanzen aufzunehmen.
Im Körper entfalten Polyphenole verschiedene Wirkungen: Sie fangen freie Radikale ab, beeinflussen Signalwege und Enzyme, und können die Zusammensetzung des Darmmikrobioms günstig verändern (Tsao, 2010). Dadurch tragen sie zum Schutz von Herz-Kreislauf-System, Gehirn und Muskulatur bei (Cory et al., 2018). Insbesondere in der Altersforschung haben Polyphenole Aufmerksamkeit erlangt, da sie mit einem verringerten Risiko für chronische Erkrankungen und funktionelle Einschränkungen in Verbindung gebracht werden (Fried et al., 2001).
Damit wird deutlich, dass sekundäre Pflanzenstoffe mehr sind als nur „Beiwerk“ der Ernährung. Sie sind entscheidende Bausteine einer präventiven, gesundheitsfördernden Ernährungsweise – und spielen eine Schlüsselrolle im Verständnis, wie Ernährung den Alterungsprozess beeinflussen kann.
Polyphenole gegen oxidativen Stress
Wie also gerade festgestellt, üben Polyphenole im menschlichen Körper eine Vielzahl von Funktionen aus, die für Gesundheit und Alterungsprozesse von zentraler Bedeutung sind. Eine der bekanntesten Wirkungen ist ihre antioxidative Wirkung: Das bedeutet, sie fangen schädliche Moleküle ab – sogenannte freie Radikale – und verhindern so, dass Zellen und Gewebe beschädigt werden (Tsao, 2010). Solche Schäden durch „oxidativen Stress“ spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz oder auch beim allgemeinen körperlichen Abbau im Alter (Cory et al., 2018).
Darüber hinaus wirken Polyphenole entzündungshemmend, indem sie die Bildung bestimmter Entzündungs-Botenstoffe hemmen und Signale im Körper abschwächen, die Entzündungen verstärken würden (Panche et al., 2016). Diese Effekte sind besonders im Kontext des Alterns relevant, da chronische, niedriggradige Entzündungen („Inflammaging“) als Schlüsselfaktor für Gebrechlichkeit und altersbedingte Krankheiten gelten.
Polyphenole beeinflussen außerdem das Gefäßsystem, indem sie die Endothelfunktion verbessern und die Blutdruckregulation unterstützen. Studien deuten darauf hin, dass eine regelmäßige Aufnahme polyphenolreicher Lebensmittel das Risiko für Bluthochdruck, Arteriosklerose und Schlaganfall reduziert (Beecher, 2003).
Ein weiterer Wirkmechanismus betrifft das Darmmikrobiom: Polyphenole fördern das Wachstum gesundheitsförderlicher Bakterien und hemmen potenziell pathogene Keime (Pérez-Jiménez et al., 2010). Damit entsteht eine Wechselwirkung, die sowohl die Aufnahme als auch die Bioaktivität dieser Substanzen verbessert.
Zusammenfassend tragen Polyphenole durch antioxidative, entzündungshemmende, gefäßschützende und mikrobiommodulierende Effekte maßgeblich dazu bei, die Funktionsfähigkeit des Körpers im Alter zu erhalten. Diese Eigenschaften machen sie zu zentralen Kandidaten in der Prävention von Altersgebrechlichkeit.
Polyphenole und ihre Wirkung im Körper
Während wir nun wissen, dass Polyphenole zu den wichtigsten sekundären Pflanzenstoffen zählen, ist entscheidend, welche konkreten Effekte sie im menschlichen Körper entfalten. Forscherinnen und Forscher haben in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Mechanismen identifiziert, die erklären, warum eine polyphenolreiche Ernährung mit einer besseren Gesundheit im Alter verbunden ist.
Ein zentraler Punkt ist die Regulation von Stoffwechselwegen, die direkt mit Alterungsprozessen zusammenhängen. Polyphenole beeinflussen Signalwege, die das Zellwachstum, die Reparatur von DNA-Schäden und die Energieproduktion in den Mitochondrien steuern (Cory et al., 2018). Dadurch tragen sie dazu bei, dass Zellen länger funktionsfähig bleiben. Darüber hinaus zeigen aktuelle Übersichtsarbeiten, dass Polyphenole die Muskelgesundheit unterstützen können. Sie bremsen Prozesse, die zum Abbau von Muskelproteinen führen, und fördern gleichzeitig die Neubildung von Muskelfasern. Das ist besonders relevant, weil Muskelschwund – die sogenannte Sarkopenie – ein zentraler Bestandteil der Altersgebrechlichkeit ist (Medoro et al., 2024; Nikawa et al., 2021).
Ein weiterer Mechanismus betrifft die Gefäßgesundheit. Polyphenole verbessern nicht nur die Funktion des Endothels, sondern regen auch die Bildung von Stickstoffmonoxid (NO) an – einem Botenstoff, der die Blutgefäße entspannt und so zu einer besseren Durchblutung vorbeugen, die eng mit Frailty verbunden sind.
Auch das Immunsystem profitiert: Polyphenole modulieren die Aktivität von Immunzellen und wirken so einer chronischen Überaktivierung entgegen. Das ist von großer Bedeutung, weil eine ständige, unterschwellige Entzündung („Inflammaging“) als einer der Hauptgründe für Gebrechlichkeit gilt (Franceschi & Campisi, 2014).
Nicht zuletzt spielt das Darmmikrobiom eine Schlüsselrolle. Polyphenole dienen als „Futter“ für nützliche Bakterien und fördern deren Vermehrung. Gleichzeitig hemmen sie das Wachstum entzündungsfördernder Keime (Pérez-Jiménez et al., 2010). Da das Mikrobiom eng mit Stoffwechsel, Immunabwehr und sogar Gehirnfunktion verbunden ist, ergibt sich hier ein weiterer Ansatzpunkt, wie Polyphenole ganzheitlich wirken können.
Zusammengefasst sind Polyphenole also weit mehr als Antioxidantien. Sie greifen an mehreren Stellen im Organismus ein: Sie stabilisieren Muskeln und Gefäße, fördern die Regeneration von Zellen, beruhigen das Immunsystem und stärken das Mikrobiom. Damit liefern sie eine überzeugende Erklärung, warum eine polyphenolreiche Ernährung das Risiko für Altersgebrechlichkeit spürbar senken kann.
Frailty-Syndrom verstehen
Altersgebrechlichkeit – in der Fachliteratur oft als „Frailty“ bezeichnet – ist ein Zustand, der vor allem ältere Menschen betrifft. Er beschreibt eine verringerte Widerstandskraft gegenüber Belastungen. Das bedeutet: Körperliche oder seelische Stressfaktoren wie eine Grippe, ein Sturz oder eine Operation führen schneller zu ernsthaften Einschränkungen als bei gesunden, gleichaltrigen Personen (Fried et al., 2001).
Die wichtigsten Kennzeichen von Frailty sind:
- spürbarer Kraftverlust in Muskeln und Händen,
- unbeabsichtigter Gewichtsverlust,
- ein langsameres Gehtempo,
- erhöhte Müdigkeit und Erschöpfung,
- sowie eine insgesamt geringere körperliche Aktivität.
Bereits drei dieser Symptome gelten als Hinweis auf das Syndrom. Betroffene sind deutlich anfälliger für Stürze, Krankenhausaufenthalte oder Pflegebedürftigkeit. Auch das Sterberisiko steigt (Clegg et al., 2013). Besonders relevant ist, dass Frailty nicht einfach eine „normale“ Alterserscheinung ist. Es handelt sich um ein eigenständiges geriatrisches Syndrom, das gezielt erkannt und behandelt werden sollte. Studien schätzen, dass etwa 10 % aller Menschen über 65 Jahre in Europa betroffen sind – bei den über 80-Jährigen sogar fast ein Drittel (Collard et al., 2012).
Die Ursachen sind vielfältig: Einerseits spielen biologische Alterungsprozesse eine Rolle, wie die Abnahme von Muskelmasse (Sarkopenie) und chronische, niedriggradige Entzündungen. Andererseits verstärken Faktoren wie Fehlernährung, Bewegungsmangel oder Erkrankungen wie Diabetes und Herzschwäche das Risiko (Franceschi & Campisi, 2014). Damit wird deutlich, warum Frailty ein zentrales Thema der Altersmedizin ist: Es entscheidet oft darüber, ob ein älterer Mensch selbstständig bleibt oder pflegebedürftig wird. Die gute Nachricht: Ernährung, Bewegung und präventive Maßnahmen können den Verlauf deutlich beeinflussen. Genau hier setzen Polyphenole als Teil einer gesunden Ernährung an.
Studienlage – Polyphenole und Altersgebrechlichkeit
In den letzten Jahren hat sich die Forschung intensiv damit beschäftigt, welchen Einfluss Polyphenole auf das Risiko für Altersgebrechlichkeit haben. Ein zentrales Ergebnis: Menschen, die regelmäßig polyphenolreiche Lebensmittel zu sich nehmen, weisen ein geringeres Risiko auf, im Alter gebrechlich zu werden.
Beobachtungsdaten aus Italien und Frankreich stützen diesen Zusammenhang: In der InCHIANTI-Studie war ein höherer Polyphenolspiegel im Urin mit einem geringeren Risiko für Frailty verbunden (Urpi-Sardà et al., 2015). Auch eine prospektive Analyse der Three-City-Bordeaux-Studie zeigte, dass bereits höhere Aufnahmemengen einzelner Flavonole – insbesondere Quercetin – das Risiko für die Entwicklung von Frailty über zwölf Jahre hinweg deutlich senken konnten (Oei et al., 2023).
Auch andere Studien bestätigen diesen Zusammenhang:
- In einer italienischen Langzeitstudie wurde beobachtet, dass ältere Erwachsene mit einer polyphenolreichen Ernährung nicht nur seltener gebrechlich wurden, sondern auch seltener Einschränkungen in Mobilität und Selbstständigkeit entwickelten (Zamora-Ros et al., 2018).
- Eine Metaanalyse von Beobachtungsstudien kam zu dem Schluss, dass polyphenolreiche Kost mit einer besseren Muskelkraft und einer geringeren Entzündungsbelastung verbunden ist – zwei entscheidende Faktoren im Zusammenhang mit Frailty (Del Rio et al., 2013).
Natürlich gilt es, Einschränkungen zu beachten. Die meisten Untersuchungen sind Beobachtungsstudien. Das bedeutet: Sie können Zusammenhänge aufzeigen, aber keine eindeutigen Ursache-Wirkungs-Beweise liefern. Außerdem spielen oft weitere Lebensstilfaktoren wie Bewegung oder allgemeine Ernährungsgewohnheiten eine Rolle, die schwer isoliert zu betrachten sind.
Trotzdem ergibt sich ein klares Bild: Eine Ernährung mit reichlich Polyphenolen ist nicht nur sicher, sondern geht mit messbaren Vorteilen für ältere Menschen einher. Sie könnte daher ein wichtiger Baustein sein, um die wachsende Herausforderung der Altersgebrechlichkeit in unserer Gesellschaft abzumildern.
Polyphenolquellen im Alltag
Polyphenole sind keine exotischen Substanzen, die man nur in speziellen Präparaten findet – sie stecken in vielen alltäglichen Lebensmitteln. Der Schlüssel liegt darin, diese bewusst und regelmäßig in den Speiseplan einzubauen.
Obst und Beeren: Besonders reich an Polyphenolen sind Beeren wie Heidelbeeren, Himbeeren, Erdbeeren und Brombeeren. Auch Trauben, Äpfel, Birnen und Kirschen liefern hohe Mengen. Schon eine Handvoll Beeren oder ein Apfel am Tag können einen wichtigen Beitrag leisten.
Gemüse: Zwiebeln, Brokkoli, Grünkohl, Spinat und Rotkohl sind klassische Gemüsesorten mit hohem Polyphenolgehalt. Sie bringen zusätzlich Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe mit.
Getränke: Grüner Tee, schwarzer Tee und Kaffee sind bedeutende Polyphenolquellen. Auch moderater Rotweinkonsum liefert Polyphenole, insbesondere Resveratrol – hier gilt jedoch Vorsicht: Der gesundheitliche Nutzen des Alkohols ist umstritten, daher sollte Wein nicht als primäre Quelle empfohlen werden.
Hülsenfrüchte und Nüsse: Linsen, Kichererbsen und Bohnen enthalten wertvolle Polyphenole, ebenso wie Walnüsse, Haselnüsse und Mandeln. Eine kleine Portion Nüsse am Tag ist nicht nur herzgesund, sondern auch ein Polyphenol-Booster.
Öle und Schokolade: Natives Olivenöl extra enthält neben gesunden Fetten auch relevante Mengen an Polyphenolen. Dunkle Schokolade (ab 70 % Kakaoanteil) ist ebenfalls eine bemerkenswerte Quelle – in Maßen genossen.
Frühstück: eine Schale Haferflocken mit Heidelbeeren und Nüssen
Mittagessen: ein gemischter Salat mit Kichererbsen und Olivenöl-Dressing
Nachmittag: eine Tasse grüner Tee und ein Stück dunkle Schokolade
So lässt sich eine polyphenolreiche Ernährung ohne großen Aufwand in den Alltag integrieren – genussvoll und abwechslungsreich.
Typische Stolperfallen
So wertvoll Polyphenole für die Gesundheit auch sind, im Alltag gibt es einige Stolperfallen, die den Nutzen schmälern oder sogar ins Gegenteil verkehren können.
- Nahrungsergänzung statt Lebensmittel
Viele greifen lieber zu Polyphenol-Kapseln oder Pulvern, weil es einfacher scheint. Doch Studien zeigen: Die Wirkung von Polyphenolen ist im natürlichen Lebensmittelverbund am größten. Dort wirken sie zusammen mit Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen – etwas, das isolierte Präparate nicht leisten können (Del Rio et al., 2013). - Versteckter Zuckeranteil bei Smoothies und Säften
Smoothies und Fruchtsäfte enthalten zwar Polyphenole, aber oft auch große Mengen an Zucker. Gerade Fertigprodukte können schnell mehr Kalorien liefern, als gedacht. Wer Polyphenole über Obst aufnimmt, sollte möglichst frische Früchte oder ungesüßte Varianten bevorzugen. - Qualität der Lebensmittel
Polyphenolgehalt ist nicht immer gleich. Er hängt von Sorte, Anbauweise und Verarbeitung ab. Bio-Produkte schneiden häufig besser ab, weil Pflanzen bei weniger intensivem Pflanzenschutz mehr eigene Abwehrstoffe bilden – und dazu gehören auch Polyphenole. Auch frische, saisonale Produkte haben meist höhere Gehalte als stark verarbeitete Lebensmittel. - Übermaß an „ungesunden“ Quellen
Manche polyphenolreiche Lebensmittel wie Rotwein oder Schokolade haben Schattenseiten: Alkohol und Zucker können in größeren Mengen der Gesundheit schaden. Deshalb gilt hier: in Maßen genießen, nicht als Hauptquelle einplanen.
Also können wir mitnehmen: Mit ein wenig Aufmerksamkeit lassen sich diese Fallstricke leicht umgehen. Wer auf frische, abwechslungsreiche und möglichst unverarbeitete Lebensmittel setzt, ist in Sachen Polyphenole auf der sicheren Seite.
Ausblick und Fazit
Die Forschung zeigt klar: Polyphenole sind ein wertvoller Bestandteil einer gesunden Ernährung, insbesondere im Hinblick auf die Prävention von Altersgebrechlichkeit. Schon drei Portionen polyphenolreicher Lebensmittel täglich können das Risiko spürbar senken – eine kleine Veränderung mit großem Effekt. Dabei geht es nicht darum, strikte Regeln aufzustellen oder bestimmte Lebensmittel zu verbieten. Vielmehr zeigen Polyphenole, dass der Schlüssel zu mehr Gesundheit im Alter in einer vielfältigen, pflanzenbetonten Ernährung liegt. Wer regelmäßig Obst, Gemüse, Nüsse, Hülsenfrüchte, Tee oder Olivenöl in den Speiseplan einbaut, stärkt nicht nur Herz, Gefäße und Muskeln, sondern auch das Immunsystem und die Darmflora.
Besonders ermutigend: Die Effekte sind alltagstauglich erreichbar. Es braucht keine speziellen Diäten oder teuren Präparate – eine bunte Auswahl an Lebensmitteln, verteilt über den Tag, genügt. Ernährung kann damit zu einem praktischen Werkzeug werden, um die eigenen Chancen auf ein gesundes, selbstbestimmtes Altern zu erhöhen.
Der Ausblick für die Forschung bleibt spannend: Zukünftige Studien werden noch genauer zeigen, welche Kombinationen von Polyphenolen besonders wirksam sind und wie sie gezielt für Präventionsprogramme genutzt werden können. Bis dahin gilt: Vielfalt auf dem Teller ist die beste Strategie – und ein einfacher Weg, heute schon in die eigene Gesundheit von morgen zu investieren.
Quellen
- Beecher, G. R. (2003). Overview of dietary flavonoids: nomenclature, occurrence and intake. Journal of Nutrition, 133(10), 3248S–3254S
- Clegg, A., Young, J., Iliffe, S., Rikkert, M. O., & Rockwood, K. (2013). Frailty in elderly people. The Lancet, 381(9868), 752–762.
- Collard, R. M., Boter, H., Schoevers, R. A., & Oude Voshaar, R. C. (2012). Prevalence of frailty in community-dwelling older persons: a systematic review. Journal of the American Geriatrics Society, 60(8), 1487–1492.
- Cory, H., Passarelli, S., Szeto, J., Tamez, M., & Mattei, J. (2018). The role of polyphenols in human health and food systems: a mini-review. Frontiers in Nutrition, 5, 87
- Franceschi, C., & Campisi, J. (2014). Chronic inflammation (inflammaging) and its potential contribution to age-associated diseases. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 69(Suppl 1), S4–S9
- Fried, L. P., Tangen, C. M., Walston, J., Newman, A. B., Hirsch, C., Gottdiener, J., … & McBurnie, M. A. (2001). Frailty in older adults: evidence for a phenotype. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 56(3), M146–M157.
- Medoro, A., Malafarina, V., & Paúl, C. (2024). Effects of polyphenol supplementation on muscle mass, strength, and performance in older adults: A systematic review and meta-analysis. Journal of Frailty & Aging, 13(2), 139–148
- Nikawa, T., Ulla, A., & Sakakibara, I. (2021). Polyphenols and muscle atrophy: A review of the potential role in aging and disuse muscle loss. Molecules, 26(16), 4887
- Oei, S. Y., Samieri, C., Féart, C., de Groot, L. C. P. G. M., & Kok, A. (2023). Flavonol and quercetin intake and risk of frailty onset over 12 years of follow-up: The Three-City-Bordeaux study. American Journal of Clinical Nutrition, 118(1), 27–33
- Panche, A. N., Diwan, A. D., & Chandra, S. R. (2016). Flavonoids: an overview. Journal of Nutritional Science, 5, e47.
- Pérez-Jiménez, J., Neveu, V., Vos, F., & Scalbert, A. (2010). Systematic analysis of the content of 502 polyphenols in foods. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(8), 4959–4969
- Del Rio, D., Rodriguez-Mateos, A., Spencer, J. P. E., Tognolini, M., Borges, G., & Crozier, A. (2013). Dietary (poly)phenolics in human health: structures, bioavailability, and evidence of protective effects against chronic diseases. Antioxidants & Redox Signaling, 18(14), 1818–1892
- Tsao, R. (2010). Chemistry and biochemistry of dietary polyphenols. Nutrients, 2(12), 1231–1246
- Urpi-Sardà, M., Bandinelli, S., Milani, C., Maggi, S., Andreoni, G., Guralnik, J. M., … & Andres-Lacueva, C. (2015). Urinary polyphenols are inversely associated with frailty status in older adults: A cross-sectional analysis from the InCHIANTI study. Journal of Nutrition, Health & Aging, 19(7), 771–776
- Zamora-Ros, R., Rabassa, M., Cherubini, A., Urpí-Sardà, M., Llorach, R., Bandinelli, S., … & Andres-Lacueva, C. (2013). High concentrations of a urinary biomarker of polyphenol intake are associated with decreased mortality in older adults. Journal of Nutrition, 143(9), 1445–1450